Soziale Informationsverarbeitung
bei Kindern
Das Modell des sozialen Austausches bei Kindern von Dodge
(1986) (siehe Abbildung 7) enthält fünf verschiedene Komponenten,
die in einer Wechselwirkung zueinander stehen: 1) Soziale Schlüsselreize,
2) soziale Informationsverarbeitung dieser Reize, 3) das Sozialverhalten
des Kindes als Konsequenz dieser Verarbeitungsprozesse, 4) Bewertung des
Verhaltens durch die Gleichaltrigen (Peers) und 5) als Reaktion darauf,
das Verhalten der Gleichaltrigen dem Kind gegenüber (Dodge, 1986;
Leffert & Siperstein, 1996; Oerter, 1995).
Dodge geht davon aus, „...that children’s social behaviors
are best understood as responses to specific situations or task" (Dodge,
Mc Claskey & Feldman, 1985, S. 351). In diesem Sinne soll Punkt 1 des
Modells (sozialer Reiz) als eine Situation verstanden werden, die eine
soziale Aufgabe enthält. Die Beurteilung von sozialer Kompetenz erfolgt
nach Dodge anhand der Bewältigung der sozialen Aufgaben. Folgerichtig
definiert Dodge soziale Kompetenz über die erfolgreiche Bewältigung
sozialer Aufgaben (Leffert & Siperstein, 1996; Oerter, 1995).
Der entscheidende Punkt in diesem Modell ist die Informationsverarbeitung
des Kindes (siehe Abbildung 8).
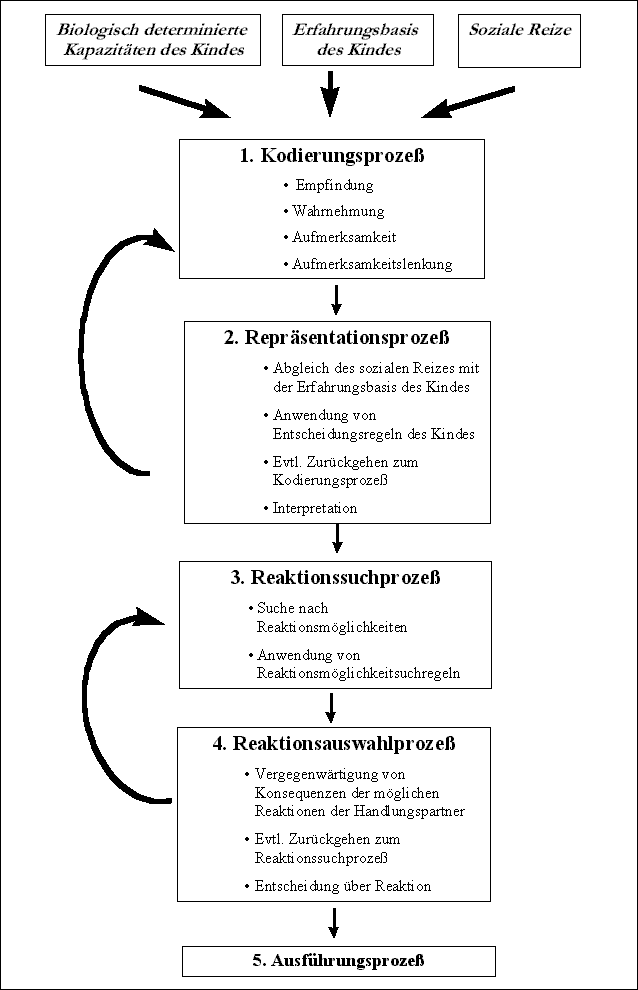
Abbildung 8: Soziale Informationsverarbeitung des Kindes
(nach Dodge, 1986, S. 84)
Der erste Schritt, die Kodierung, enthält die Wahrnehmung
der sozialen Situation. Leffert und Siperstein (1996) benutzen in ihrer
Arbeit, analog zu Dodge (1986), den Begriff ‘encoding’. Dieser wurde vom
Autor der vorliegenden Arbeit als ‘Wahrnehmung der sozialen Situation’
übersetzt. Darunter soll die Richtung von selektiver Aufmerksamkeit
auf die entscheidenden sozialen Schlüsselreize und ihre Erkennung
und Kategorisierung verstanden werden (siehe Punkt 1.2.6).
Im zweiten Schritt wird dieser Schlüsselreiz vom
Kind interpretiert. Es wird versucht, die Intentionen des Interaktionspartners
zu deuten. Im dritten Schritt sucht das Kind Reaktionsmöglichkeiten
auf das Verhalten des Partners. Als viertes werden dessen mögliche
Gegenreaktionen auf die Reaktionsmöglichkeiten des Kindes gesammelt
und bewertet. Nach dem Durchlaufen dieser vier kognitiven Prozesse erfolgt
erst die Reaktion des Kindes. Es muß natürlich angemerkt werden,
daß im Normalfall dieser Prozeß unbewußt und automatisiert
abläuft. Erst bei sehr komplexen und schwierigen sozialen Aufgaben
werden Teile dieses Prozesses bewußt durchgeführt (Dodge, 1986).
Im Folgenden wollen wir uns etwas genauer mit der Informationsverarbeitung
des Kindes anhand des Dodge-Modells beschäftigen.
Im oberen Teil der Abbildung 8 sind drei vom Kind in der
aktuellen Situation nicht beeinflußbare Basisfaktoren des Modells
dargestellt. Ein Basisfaktor sind die biologisch determinierten Kapazitäten
des Kindes. Hierunter sind die biologischen Wahrnehmungsfähigkeiten
des Kindes zu verstehen, also die physische Qualität der Augen, der
Ohren, etc.. Unter diesen Punkt fällt auch die Intelligenzausprägung
des Kindes. Unter Erfahrungsbasis des Kindes verstehen wir die im Gedächtnis
abgespeicherten bisherigen Erfahrungen des Kindes. Dritte Basisvoraussetzung
des Modells ist das Vorhandensein von sozialen Reizen, auf die das Kind
reagieren muß.
Im Kodierungsprozeß (encoding process) spielen die
Punkte Empfindung, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitslenkung
die zentrale Rolle. Dodge (1991) beschreibt, daß innere Regeln (internal
rules) die Zuweisung von selektiver Aufmerksamkeit steuern. Als Beispiel
führt er die angeborene oder in früher Kindheit erlernte Lenkung
der Aufmerksamkeit auf menschliche Gesichtsausdrücke an.
Die Wahrnehmung des sozialen Reizes ist die Grundvoraussetzung
für den erfolgreichen Durchlauf der späteren Schritte. Da die
Wahrnehmungskapazität eines Individuums allerdings kleiner ist als
die Masse der wahrnehmbaren Reize, muß das Individuum sich auf die
Wahrnehmung der wesentlichen Schlüsselreize beschränken. Hierfür
ist es erforderlich, daß es Aufmerksamkeit entwickeln kann und in
der Lage ist, diese auf die relevanten Reize zu richten (siehe Punkt 1.2.6).
Die in der Wahrnehmungssituation vorhandenen Empfindungen und die wahrgenommenen
Reize der sozialen Situation werden kodiert und im kognitiven System abgespeichert.
Im Repräsentationsprozeß gleicht das Kind die
im Kodierungsprozeß gewonnen Informationen mit seinen bisher gemachten
Erfahrungen ab. Falls die Informationen nicht ausreichen um diesen Abgleich
durchzuführen, muß das Kind den Kodierungsprozeß noch
einmal durchlaufen. Anhand des durchgeführten Abgleiches versucht
das Kind, die Situation zu interpretieren. Dabei geht es nach im Laufe
des Lebens aufgebauten Bearbeitungsregeln vor. Die Bearbeitungsregeln sind
aus den bislang gemachten Erfahrungen erwachsen. So kann das Kind ein Wegnehmen
eines Spielzeuges durch einen Gleichaltrigen als Scherz oder als Ärgern
auffassen. In der Therapie von aggressiven Verhalten ist die Veränderung
dieser Bearbeitungsstrategien ein zentraler Punkt (Petermann & Petermann,
1990).
Im dritten Schritt, dem Reaktionssuchprozeß, werden
die vorhandenen Verhaltensmöglichkeiten gesichtet. Das Kind wendet
hier wieder, wie im Punkt 2 des Modells, eine im Laufe der Jahre von ihm
aufgebaute Suchstrategie an. Hierbei liegt zwangsläufig nahe, das
häufig verwendete Verhaltensweisen am schnellsten in die engere Wahl
gezogen werden. Asarnow & Callan (1985) zeigen in einer Untersuchung,
daß Kinder, die häufig verbal aggressive Lösungen als optimale
Lösungen präsentieren, besonders häufig aggressives Verhalten
in ihrer realen Umwelt zeigen.
Im vierten Schritt, dem Reaktionsauswahlprozeß (Response
Decision Process), werden die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten
auf ihre Konsequenzen hin überprüft. Das Kind sucht die Möglichkeit
aus, deren Konsequenzen für sich am positivsten sind. Überprüfte
Konsequenzen können nach Dodge (1991) sein:
· Werden die anderen Kinder mich nach meiner Reaktion
noch mögen?
· Erreiche ich mit meinem Verhalten, was ich erreichen
will?
· Kann ich dieser Handlung moralisch zustimmen?
Das Kind wägt ab, welche von den möglichen Konsequenzen
wichtiger und welche unwichtiger sind. Es kann sich zum Beispiel die Frage
stellen:
· Ist es in dieser Situation wichtig, daß
die anderen Kinder mich mögen?
Enthält keine der im Punkt 3 ausgewählten Reaktionsmöglichkeiten
positive Konsequenzen für das Kind, wird die Suche nach Reaktionsmöglichkeiten
noch einmal durchlaufen. Am Ende dieses vierten Schrittes fällt das
Kind eine Entscheidung über die auszuführende Reaktion.
Dodge (1986) verglich ursprünglich den Ablauf dieses
Prozesses mit der Arbeit eines Computers. Später revidierte er diese
Sichtweise (Dodge, 1991). Er schreibt: „I propose that all information
processing is emotional, in that emotion is the energy level that drives,
organizes, amplifies, and attenuates cognitive activity and in turns is
the experience and expression of this activity." (S. 159).
Döpfner entwickelte eine Jahre später in Deutschland
eine mit dem Dodge-Modell nahezu deckungsgleiche Theorie (vgl. Döpfner,1989;
Döpfner, Lorch & Reihl, 1989).
Dodge und Feldman (1990) stellen fest, daß ein Zusammenhang
zwischen dem sozialen Status des Kindes und seiner sozialen Kognition besteht.
Unpopuläre Kinder besitzen danach eine geringere Reizdifferenzierungsfähigkeit.
Sie zeigen bei persönlichen Problemen verstärkt interne Attributionen.
Sie generieren mehr inkompetente Verhaltensantworten. Besonders häufig
werden von ihnen auch aggressive Verhaltensantworten generiert. Nach Dodge
und Feldman (ebd.) zeigen sich aber wenig Hinweise auf eine generell niedrigere
Intelligenz oder schlechtere Informationsverarbeitung bei unpopulären
Kindern. Sie schreiben:
„Little evidence has accumulated that low-status children
have general intellectual or processing deficits; their deficits and processing
biases appear to be specific to particular situations, especially situations
that are potentially stressful or threatening and are relevant to social
functioning for their particular age and sex subculture group" (S.
150).
Bezieht man das Dodge-Modell auf geistig behinderte Kinder,
liegt der Schluß nahe, daß diese zwangsläufig schlechteres
Sozialverhalten als nicht geistig behinderte Kinder zeigen müssen.
Die biologisch determinierten Kapazitäten dieser Kinder sind aufgrund
der Retardierung erheblich kleiner. Dieses trifft vor allem auf die Intelligenzausprägung
zu. Es führt dazu, daß geistig behinderte Kinder zwangsläufig
schlechtere Bearbeitungsstrategien, die in den Schritten zwei und drei
des Modells benötigt werden, entwickeln müssen. Weiterhin ist
die verfügbare Erfahrungsbasis aufgrund von Problemen mit der Abspeicherung
von Erfahrungen im kognitiven System und Problemen mit dem Zugriff auf
die abgespeicherten bisher gemachten Erfahrungen (Suchstrategien) erheblich
kleiner.
Da mit dem Grad der geistigen Behinderung auch die Zusatzbehinderungen
zunehmen, ist davon auszugehen, daß ein nicht unerheblicher Teil
dieser Menschen auch erheblich schlechtere physische Wahrnehmungsfähigkeiten
besitzt.
Zusätzlich haben viele geistig behinderte Kinder,
aufgrund ihrer Lebensbedingungen, erheblich schlechtere Möglichkeiten,
eine ausreichende Erfahrungsbasis aufzubauen. Weiterhin gilt zu vermuten,
daß geistig behinderte Kinder, im Verhältnis zu nicht geistig
behinderten Kindern, erheblich häufiger einen schlechten sozialen
Status besitzen.
